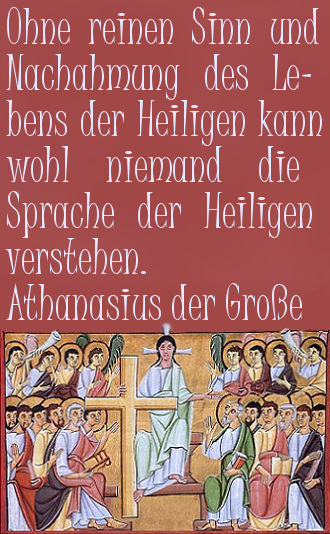Kategorie: Heilige
Philipp Neri – Eucharistische Frömmigkeit
Philipp Neri hatte eine besonders innige Beziehung zum allerheiligsten Sakrament. Ohne Eucharistie konnte er nicht leben: Es war für ihn selbstverständlich, täglich die Heilige Messe zu feiern.
Die Anbetung vor dem Allerheiligsten war für ihn nicht eine Andachtsform unter anderen, sondern sie war das Zentrum seines geistlichen Lebens. Aus der Eucharistie schöpfte er seine ganze Kraft, um den Armen und Kranken zu dienen und sie zu lieben.
Seine Verehrung des allerheiligsten Sakramentes ging sogar so weit, dass er während der Feier der Eucharistie regelmäßig in Ekstase geriet. Die letzten Jahre seines Lebens bekam er die päpstliche Erlaubnis, für sich alleine zelebrieren zu dürfen. Dies ermöglichte Philipp Neri, ungestört in inniger Anbetung zu verweilen und hielt auch Schaulustige fern, denn es sprach sich bald herum, dass er Philipp Neri dabei sogar ein Stück über dem Boden zu schweben begann. Auch einige Zeit nach der Messfeier war er immer noch in so tiefer Andacht versunken, dass er das Geschehen um sich herum nicht wahrnahm.
Seine letzte Heilige Messe feierte Philipp Neri am Fronleichnamstag des Jahres 1595. Als er kurz vor seinem Tod die Wegzehrung empfing sagte er:
Ich bin nicht würdig, ich bin niemals würdig gewesen; komm mein Liebster!
Philipp Neri – Lehrer des Gebets
 Das Gebet prägte das Leben von Philipp Neri. Die Gemeinschaft, die sich um ihn versammelte und die sich später zu einem Orden weiterentwickelte, nennt sich Oratorium. Oratorium ist eigentlich der Gebetsraum. Zunächst kamen die Freunde Philipp Neris in einem Raum auf dem Dachboden der Kirche zusammen. Das Gebet prägte die Gemeinschaft, aber auch Musik (daraus entstand die Musikgattung des Oratoriums!) und bildende Vorträge waren von Bedeutung.
Das Gebet prägte das Leben von Philipp Neri. Die Gemeinschaft, die sich um ihn versammelte und die sich später zu einem Orden weiterentwickelte, nennt sich Oratorium. Oratorium ist eigentlich der Gebetsraum. Zunächst kamen die Freunde Philipp Neris in einem Raum auf dem Dachboden der Kirche zusammen. Das Gebet prägte die Gemeinschaft, aber auch Musik (daraus entstand die Musikgattung des Oratoriums!) und bildende Vorträge waren von Bedeutung.
Philipp Neri war ein Lehrer des Betens. Er selbst konnte sehr leicht vom mündlichen Beten in eine tiefe Betrachtung übergehen. Daher betete er gerne das Brevier in Gemeinschaft, beim Beten für sich kam er mit dem Brevier an kein Ende, da er an vielen Stellen immer wieder in Betrachtung verfiel.
Einige seiner Aussprüche deuten an, wie viel Wert er auf das Beten legte:
Wir dürfen unser Beten und Bitten nicht aufgeben, nur weil wir nicht sofort das erhalten haben, worum wir als erstes gebeten haben.
Wir sollen und oft daran erinnern, dass Christus sagte, dass jener gerettet wird, der bis zum Ende aushält, nicht der, der beginnt.
Wer nicht in der Lage ist, längere Zeit im Gebet auszuhalten, der sollte seinen Geist durch Stoßgebete zum Herrn erheben.
Gerade diese Stoßgebete wurden zu einem Charakteristikum seines Betens, das er auch anderen weitergab. Gebetsformeln wie „Jesus, sei mir Jesus!“ oder „Maria, Jungfrau und Mutter!“ sind verwandt mit dem Herzensgebet, das wir aus der Ostkirche kennen. Sie können uns durch den Alltag tragen, indem wir sie in unseren täglichen Beschäftigungen immer wieder im Herzen beten. Sie können uns aber auch in eine tiefe Betrachtung einführen, indem wir sie in Zeiten der stillen Meditation in Einklang mit unserem Atem wiederholen.
Philipp Neri – Der humorvolle Heilige
Philipp Neri war von seinem Wesen her ein zutiefst fröhlicher Mensch. Viele Anekdoten aus seinem Leben zeugen davon. Es mag uns vielleicht verwundern wie diese Fröhlichkeit mit seiner tiefen Frömmigkeit zusammengehen kann. Doch Frömmigkeit und Fröhlichkeit sind keine Gegensätze. Der Glaube soll uns ja zu fröhlichen Menschen machen. „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!“ Diesen Wunsch hat schon Paulus in seinen Briefen zum Ausdruck gebracht.
Mit dieser Fröhlichkeit konnte Philipp Neri viele Menschen gewinnen und sie so zu einem tieferen Glauben führen. Wahre Fröhlichkeit ist nicht aufgesetzt, sondern kommt aus der Ruhe des Herzens. Freilich, es ist auch jeder Mensch anders und manche haben eher einen stillen und ernsten Charakter. Somit war seine Fröhlichkeit Philipp Neri in gewisser Weise auch in die Wiege gelegt. Aber doch können wir uns ein wenig anstecken lassen von dieser Freude, die aus einem Herzen kommt, das die Liebe Gottes erfahren hat.
Eine Anekdote berichtet, wie humorvoll selbst die strenge Lektion eines Beichtvaters sein kann. Viele Adlige Roms kamen zu Philipp Neri in den Beichtstuhl, unter ihnen auch die Contessa Bianchi. Ihr Fehler war es, dass sie des Öfteren in Gesellschaft schlecht über andere redete. Dafür bekam sie von Philipp Neri folgende sonderbare Buße auferlegt: Sie solle sich am Markt ein Huhn besorgen und dann damit zu ihm kommen. „Unterwegs musst du es so gut rupfen, dass dabei auch nicht eine Feder übrigbleibt.“
Es muss ein herrlicher Anblick gewesen sein, als die Contessa federrupfend durch die Straßen Roms gezogen ist. Doch es war nicht die Absicht Philipp Neris, die adlige Frau bloßzustellen. Als sie endlich mit dem gerupften Huhn zu ihm kam, erteilte er ihr die eigentliche Lehre. Sie solle nun den Weg wieder zurückgehen und alle Federn einsammeln. Als sie entgegnete: „Das ist doch nicht möglich! Der Wind hat die Federn bereits in ganz Rom verweht.“ antwortete ihr der Heilige: „Daran hättest du vorher denken müssen. So wie du die einmal ausgestreuten Federn nicht mehr aufsammeln kannst, weil der Wind sie verweht hat, so kannst du auch die bösen Worte, die du einmal ausgesprochen hast, nicht wieder zurücknehmen.“
Beten wir darum, dass auch wir etwas von diesem Humor des Heiligen zu spüren bekommen mit einem Gebet von Kardinal John Henry Newman, der selbst Oratorianer und ein großer Verehrer des Heiligen Philipp Neri war:
Heiliger Philipp, du hast immer die Lehre und das Beispiel des heiligen Apostels Paulus befolgt, indem du dich stets über alle Dinge freutest. Erlange mir die Gnade einer vollkommenen Hingabe an Gottes Willen, des Gleichmuts gegenüber den Dingen dieser Welt und lass mich stets den Himmel vor Augen haben, so dass ich über die göttlichen Fügungen nie enttäuscht bin, nie verzage, nie traurig oder missmutig werde; dass mein Gesicht immer offen und fröhlich sei und meine Worte freundlich und gütig, wie es denen zukommt, die in jeder Lebenslage das köstlichste der Güter ihr eigen nennen: die wohlwollende Liebe Gottes und die Hoffnung auf die ewige Seligkeit. Amen.
Hermann Josef von Steinfeld (um 1150 – 1241)
Hermann Joseph wurde um das Jahr 1150 in Köln als Sohn verarmter Bürger geboren. Mit zwölf Jahren kam er in das Prämonstratenserkloster Steinfeld in der Eifel. Sein religiöser Eifer, den er schon als Kind entwickelt hatte, wurde beim Anblick der Trägheit mancher Mitbrüder schwer enttäuscht. Was ihn trug war seine tiefe Verehrung der Muttergottes. Sie soll ihm folgenden Satz zum Trost gegeben haben:
„Wisse, dass du mir nichts Angenehmeres tun kannst, als deinen Brüdern in aller Liebe zu dienen.“
Dieser Satz trug ihn auch durch schwere Zeiten, als er von seinen Diensten im Kloster so beansprucht war, dass er kaum mehr Zeit für Gebet und Betrachtung fand. Als er nach einiger Zeit den Dienst des Sakristans übernahm, konnte er dem Herrn wieder näher sein, da sich seine Arbeiten auf den Raum der Kirche konzentrierten.
Seine innige Verehrung der Muttergottes blieb für ihn kennzeichnend. Diese ging sogar so weit, dass er sich auf mystische Weise mit Maria vermählte. Sein zweiter Name Josef sollte auf diese Nähe zu Maria hinweisen. Die mystische Vermählung Hermann Josefs mit der Gottesmutter hat später Antonius van Dyck (1599-1641) in einem Gemälde dargestellt.
Nach seiner Priesterweihe zeichnete sich Hermann Josef als eifriger Seelsorger aus, der ein Herz für seine Mitmenschen hatte und sich für ihre leiblichen und seelischen Nöte einsetzte. Er war ein begehrter Beichtvater und Seelenführer der Ordensfrauen in verschiedenen Klöstern.
Von seiner tiefen mystischen Frömmigkeit geben mehrere Hymnen und Gebete Ausdruck, die bis in unsere Zeit erhalten geblieben sind, darunter der große Marienhymnus „Gaude, plaude, clara Rosa“, der Hymnus auf das heiligste Herz Jesu „Summi Regis cor, aveto“, ein Jubellied auf die heilige Ursula und ihre Gefährtinnen „O vernantes Christi rosae“ und die zwölf Dankgebete zum Erlöser. Eine tiefe eucharistische Frömmigkeit bringt der Hymnus „Jesu, dulcis et decore“ zum Ausdruck.
Hermann Josef starb in hohem Alter im Kloster der Zisterzienserinnen in Hoven bei Zülpich, denen er während der Fastenzeit einen Besuch abstattete. Seine Mitbrüder drängten jedoch auf eine Überführung des Leichnams ins Kloster Steinfeld, wo er bis heute seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Obwohl er vor allem von der Bevölkerung der Eifel aber auch weit darüber hinaus schon seit seinem Tod verehrt wurde, erfolgte seine offizielle Heiligsprechung erst im Jahr 1960.
Heiliger Pachomius
Zeugen sein, das ist ein Auftrag des auferstandenen Herrn an seine Jünger. In der Frühzeit des Christentums gab es viele Möglichkeiten zu diesem Zeugnis. Der Glaube war bedroht und wer sich zu Jesus Christus bekannte, der tat dies oft unter Lebensgefahr. Doch die Zeiten änderten sich. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts bekannte sich ein Großteil der Bevölkerung des Römischen Reiches zum Christentum. Wie konnte man hier Zeuge sein?
Eine Antwort auf diese Frage ist das Mönchtum. Zunächst waren es nur einzelne, die in die Wüste gingen, um dort unter härtesten Bedingungen ein lebenslanges Martyrium als ein Zeugnis für den lebendigen Gott zu führen. Mönche, die sich im Leben in der Einsamkeit bewährt hatten, unterwiesen die Neuankömmlinge. Die Worte dieser Wüstenväter sind bis heute eine Quelle der Weisheit. Doch letztlich war in der Wüste jeder auf sich gestellt und lebte für sich in seiner Zelle und musste selbst seinen Weg der Nachfolge Jesu finden.
Auch Pachomius zog es in die Einsamkeit. Als Kind heidnischer Eltern um das Jahr 290 in Ägypten in der oberen Thebais geboren, wurde Pachomius zunächst Soldat und kämpfte in den Wirren um die Vorherrschaft im Römischen Reich, aus denen Konstantin als Alleinherrscher hervorging. Als die Truppe des Pachomius einmal in ein christliches Dorf kam, begegnete er zum ersten Mal bewusst christlichen Menschen. Er war von ihrer Lebensweise so begeistert, dass er sich bald darauf selbst entschied, Christ zu werden. Nach dem Sieg Konstantins wurde Pachomius aus dem Heer entlassen und kehrte in seine Heimat zurück und ließ sich wahrscheinlich im Jahr 314/15 taufen.
Nun ging Pachomius in die Wüste, um das Leben eines Einsiedlers zu erlernen. Er hörte von dem erfahren Mönch Palamon. Erst nach einigem Zögern war dieser bereit, Pachomius als Schüler anzunehmen. Doch bald zeigte sich, mit welchem Eifer Pachomius bereit war, das Leben eines Einsiedlers zu erlernen und er machte schnell Fortschritte darin.
Doch Pachomius wurde kein Einsiedler oder Wüstenvater, sondern er schuf etwas gänzlich Neues. Er wurde der Begründer des zönobitischen Mönchtums, wie wir es bis heute kennen. Die Mönche leben in Gemeinschaft unter einem Vorsteher und einer Regel in einem Kloster zusammen.
Das erste Kloster des Pachomius entstand in Tabennesis. Bald sollten weitere hinzukommen. Seine Regel, die das Zusammenleben der Mönche ordnete, soll Pachomius von einem Engel empfangen haben. Zeiten des Gebetes wechselten mit denen der Handarbeit. Die Nahrung der Mönche war einfach, die Nachtruhe durch Gebetswachen unterbrochen. Die Regel verlangte unbedingten Gehorsam und die Unterdrückung jedes Eigenwillens und schrieb den Mönchen bestimmte asketische Übungen vor. Ein erfahrener Mönch wurde als Verwalter bestellt, um die Erzeugnisse des Klosters in der Stadt zu verkaufen und nötige Gerätschaften einzukaufen.
Zunächst gab es unter den Mönchen keine Priester. Diese kamen von auswärts, um mit den Mönchen die Heilige Messe zu feiern. Doch bald wurden Priester in die Klöster aufgenommen und später auch einige der Mönche zu Priestern geweiht. Um das Jahr 330 zog Athanasius der Große, Bischof von Antiochien, durch Ägypten und besuchte die Klöster des Pachomius.
Doch nicht nur Männer lebten fortan in Klöstern, es entstanden auch Frauenklöster. Das erste davon wurde der Leitung der Schwester des Pachomius unterstellt. Die Klöster wuchsen zu heiligen Städten, in denen hunderte, ja manchmal sogar tausende Mönche lebten. Als Pachomius im Jahr 346/8 starb, gehörten seinem Klosterverband neun Männerklöster und zwei Frauenklöster an.
Zeichen der Liebe
Florian und die heiligen Märtyrer von Lorch (+ 304)
Florian stammt aus Noricum, einer römischen Provinz auf dem Gebiet des heutigen Österreich. Sein Geburtsort ist das römische Cetium (heute: St. Pölten). Der Name Florian bedeutet der Blühende, Mächtige (von lat. florere – blühen).
Wie viele seiner Zeitgenossen versuchte Florian sein Glück bei den Legionen des Römischen Reiches, wo er bald zum Offizier aufgestiegen ist. Sein Einsatzort wurde das stark befestigte Donaukastell Lorch, das auf dem Gebiet der heutigen Stadt Enns lag.
Doch auch noch etwas anderes beeindrucke den jungen Mann. Man hörte von einer ganz besonderen Religion, die sich auf einen Jesus Christus berief, der am Kreuz gestorben sein soll für das Heil der Menschen. Im 3. Jahrhundert breitete sich das Christentum bis in die entferntesten Provinzen des Römischen Reiches aus. Auch Florian und einige seiner Kameraden ließen sich taufen und wurden so zu Christen.
Es ist nicht ganz klar, ob Florian noch im Dienst war oder bereits Veteran des römischen Heeres, als unter Kaiser Diokletian zwischen 303 und 305 heftige Verfolgungen über die Christen hereinbrachen. Wegen seines vornehmen Standes wollte Florian für die bedrohten Mitchristen im Heer Fürsprache einlegen, jedoch vergebens.
Man versuchte die Christen durch Folterqualen dazu zu bringen, ihren Glauben zu leugnen. Zunächst scheute man sich, auch an den verdienten uns allseits bekannten Florian Hand anzulegen. Schließlich bald ihn jemand einen Mühlstein um den Hals und stürzte Florian in die Enns. Zusammen mit Florian erlangten vierzig seiner Gefährten an jenem Tag das Martyrium.
Die Legende berichtet davon, dass sein Leichnam an einem Felsen angeschwemmt und dort von einem Adler beschützt wurde. Eine fromme Witwe namens Valeria lud den Leichnam auf einen Ochsenkarren und man bestattete den Heiligen dort, wo die Tiere stehen blieben. An diesem Ort steht heute das Stift St. Florian.
Große Bedeutung erlangte Florian, als er im Mittelalter zum Beschützer in Feuersnöten wurde. Bis heute ist er Patron der Feuerwehr.
Stille
Wir müssen Gott finden – und wir können ihn nicht im Lärm und in der Unruhe finden. Gott ist ein Freund der Stille.
Schau, wie alles in der Natur – Bäume, Blumen, Gras – in Stille wächst. Schau auf die Sterne, den Mond und die Sonne, wie sie sich in Stille bewegen.
Wir brauchen Stille, um die Seele berühren zu können.
Mutter Theresa